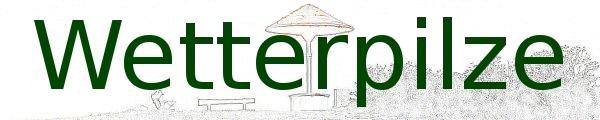| ehem. Wetterpilz am Elster-Saale-Kanal | ||||||||||||||||||||||||
| vollendeter Pilzgenuss am unvollendeten Kanal | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Kommentare (1):
Fri, 12 Aug 22 17:37:16 ():
Leider gibt es diesen Wetterpilz -Stand August 2022- nicht mehr. Schade
Wetterpilz Bericht
Leider gibt es diesen Wetterpilz nicht mehr. Die Nachricht kann am 11.08.2022. Schade - aber trotzdem soll der alte Beschreibungstext stehen bleiben: Er wirkte im Gegensatz zu den vielen anderen Wetterpilzen der Region etwas "abgemagert" - sprich: er hatte nur einen ganz dünnen Stamm. Es kann allerdings auch sein, dass dieser früher einmal mit Holz eingekleidet war. Mit seiner offenen Bauweise gestattete er Einblicke in eine ungewöhnliche Deckenkonstruktion, in der die Querbalken nicht horizontal bis zum Rand sondern in steilem Winkel nach oben geführt waren.
Rund um den Pilz
Ein System endloser Wasseradern prägt die Landschaft rund um Leipzig und Halle. Aber nicht alle Adern sind schiffbar und so plante man bereits 1920 eine Verbindung der Elster mit der Saale. Die Bauarbeiten, die kriegsbedingt in den 40er Jahren abgebrochen wurden, hinterließen nur ein Teilstück mit jedoch imposanten Besonderheiten wie der unvollendete Schleuse in Wüsteneutzsch (und diesem Wetterpilz). Von der Halleschen Seite aus nennt man diesen Kanal übrigens Saale-Elster Kanal, seit 1999 lautet seine Bezeichnung gem. Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes Saale-Leipzig-Kanal. Nach Auskunft des Amtes für Stadtgrün und Gewässer der Stadt Leipzig wurden die Leipziger Wetterpilze in den 70 er bzw. 80 er Jahren von der sogenannten Direktion Naherholung errichtet.